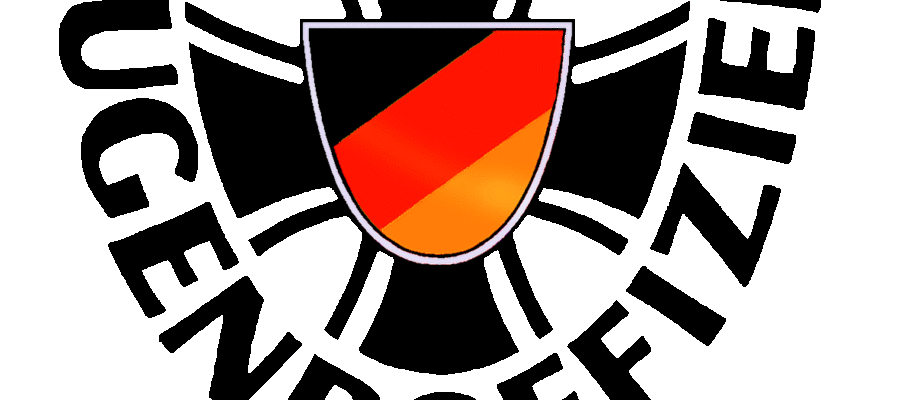Interview
Gespräch mit Hauptmann Christian Rumpel/Hauptmann Philipp Nürnberger, Jugendoffiziere Würzburg
Das Gespräch führte Lisa Schmachtenberger, Q 12
L. Sch.: Ist die Bundeswehr ein beliebter Arbeitgeber bei Jugendlichen und wenn ja, warum?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Ein beliebter Arbeitgeber ist die Bundeswehr im Grunde genommen schon; es ist zu fragen, wann Beliebtheit anfängt und im Vergleich zu wem. Durch den Wegfall der Wehrpflicht ist die Bundeswehr zu einem Arbeitgeber wie andere auch in dem Sinne geworden, dass auch die Bundeswehr sich aktiv um Nachwuchs bemühen muss; wir haben nicht mehr den „Luxus“, dass Wehrdienstleistende quartalsweise zur Bundeswehr kommen und mehr oder weniger freiwillig eine gewisse Zeit ableisten müssen, wovon sich natürlich viele entscheiden zu bleiben. Man tritt jetzt in Wettbewerb mit zivilen Firmen; und da muss die Bundeswehr das herausstellen, was sie besonders macht: Es ist kein Beruf wie jeder andere, sondern er ist mit gewissen Pflichten verbunden; es besteht eine tiefere Beziehung von Geben und Nehmen als es bei einem zivilen Arbeitgeber der Fall ist, und jeder Jugendliche muss für sich abwägen, ob es für ihn in Frage kommt, ein solches Verhältnis einzugehen.
Hauptmann Christian Rumpel: Wenn ich mich frage, was für mich die Beweggründe waren, zur Bundeswehr zu gehen, so war das einerseits die Abenteuerlust sowie zu wissen, dass man vielseitig eingesetzt wird. Zum anderen war es für mich die finanzielle Unabhängigkeit, das relativ gute Gehalt und die damit verbundene finanzielle Sicherheit.
L. Sch.: Sind der Job bei der Bundeswehr und Familie miteinander vereinbar bzw. wird dies als vereinbar empfunden?
Hauptmann Christian Rumpel: Ich bin selbst Vater von zwei Kindern, meine Frau ist Grundschullehrerin. Es ist nicht immer ganz einfach, kommt immer auf den Dienstposten an, weil man ganz vielseitig bei der Bundeswehr eingesetzt werden kann. Ich hatte bis jetzt immer Glück, meine Familie konnte immer bei mir sein. Ich habe lange in München gewohnt und bin von dort täglich nach Ingolstadt gependelt, konnte meine Kinder jeden Tag sehen. Auch jetzt in Würzburg – wir wohnen in Zell und die Kaserne ist in Veitshöchheim – geht das. Aber ich bin die Ausnahme bei der Bundeswehr; es gibt viele Wochenendpendler unter den Soldaten; die sind die ganze Woche von ihrer Familie getrennt, müssen sich Sonntagnachmittag von den Kindern verabschieden, damit sie nach 300, 400 km Fahrt abends in der Kaserne ankommen, die Freitagnachmittag wieder zurückfahren; das ist bei vielen die Regel. Auch Ehen gehen dadurch in die Brüche. Die familiäre Vereinbarkeit ist gegeben, doch es ist schwierig.
Auch Auslandseinsätze sind natürlich immer präsent; man ist dann schnell mal vier bis sechs Monate von der Familie abgeschnitten; dessen muss man sich bewusst sein. Ob das mit 17 oder 18 der Fall ist, wenn man sich für die Bundeswehr entscheidet, will ich in Frage stellen. Für die Ehefrau ist es sicher nicht einfach, wenn der eigene Mann oft unterwegs ist. Man muss sich untereinander verstehen, die Beziehung muss in Ordnung sein.
Zusammenfassend kann man sagen: Ja, es ist mit Sicherheit eine Herausforderung, aber es ist möglich, und seitdem Ministerin von der Leyen das Verteidigungsministerium geführt hat, ist es deutlich besser geworden. Es wird einem beispielsweise aufgezeigt, dass man länger an einem Dienstort bleiben, an diesem Dienstort mehrmals andere Verwendungen annehmen kann; auch damit ist die Bundeswehr deutlich attraktiver geworden.
L. Sch.: Ist die Bezeichnung „dienen“ im Slogan der Bundeswehr „Wir.Dienen.Deutschland.“ für die Leistungen der Bundeswehr gegenüber der Gesellschaft zeitgemäß? Spricht er die Jugend an?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Tatsächlich fand ich den Slogan am Anfang schon sehr plakativ; doch je länger ich darüber nachgedacht habe, desto passender fand ich ihn. „Dienen“ ist der Wesenskern dessen, was wir hier tun; es beschreibt dieses Dienstverhältnis.
Es geht darum, auf der Grundlage der Verfassung unserer Bundesrepublik zu dienen; und das schließt auch besondere Strapazen ein. Auslandseinsätze sind nur das eine; es gibt auch im täglichen Dienst noch ganz andere Herausforderungen, zum Beispiel Übungsplatzaufenthalte über mehrere Wochen, Einsatzvorausbildung, verschiedenste Arten von Lehrgängen, wegen derer man wochenweise in der ganzen Bundesrepublik unterwegs ist; das sind alles Dinge, die sich auch auf das Privatleben auswirken.
Aber diese Härten gehören zum Beruf dazu, auch körperliche Härten in der Ausbildung, die man durchstehen muss, was aber letztendlich zum Zweck hat, dass man einsatztauglich ist, dass man den Auftrag, den die Politik uns gibt, auch erfüllen kann. Von daher finde ich den Slogan sehr passend. Ob er explizit die Jugend anspricht, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber wenn man sich als Jugendlicher mal darauf einlässt, ist es zumindest ein Slogan, der nichts beschönigt oder vorspielt. Er enthält den Wesenskern, dieses intensive Geben und Nehmen; und in dem Sinne ist es recht treffend.
L. Sch.: Wie hat sich die Haltung der Gesellschaft zur Bundeswehr durch den Corona-Einsatz verändert? Wie hat sich insbesondere die Haltung junger Erwachsener geändert?
Hauptmann Christian Rumpel: Es ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit für die Bundeswehr, innerhalb Deutschlands ihre Daseinsberechtigung zeigen zu können, einen Corona-Einsatz unterstützen zu können und dementsprechend ein positives Signal zu senden. Viele Bürger in Deutschland sehen das nicht, weil man schlecht einfach mal nach Mali oder Afghanistan oder Litauen schauen kann.
Dementsprechend denke ich, dass es für uns Soldaten zwar herausfordernd, doch wichtig ist, auch im Inland, wenn wir gebraucht werden, gesehen und angenommen zu werden. Wir haben schon den Eindruck, dass den Kameraden, die in einem Gesundheitsamt ihren Dienst tun und telefonische Nichtverfolgungen oder Ähnliches machen, das auch angerechnet wird. Die Bundeswehr ist vor Corona beispielsweise auch bei dem großen Schneechaos in Bayern oder bei Hochwasser zum Einsatz gekommen; hier können wir der Bevölkerung zeigen, dass sie auf uns zählen kann.
Zwischenbemerkung: Es ist ja insgesamt so, dass die Bundeswehr in der Öffentlichkeit gar nicht mehr so präsent ist, auch, weil die Wehrpflicht ausgesetzt ist.
Hauptmann Christian Rumpel: Richtig, und wenn man präsent ist, dann oftmals negativ, z.B. durch Geschichten wie die mit Franco A., Rechtsextremismus in der Bundeswehr, Materialmängel; das ist negative Presse und deshalb ist es für uns umso wichtiger, hier auch helfen und dies zeigen zu können, auch für ein positives Feedback in der Presse.
L. Sch.: Weshalb sind Sie Jugendoffizier geworden?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Mit der Tätigkeit als Jugendoffizier beschäftigt man sich eigentlich gar nicht, wenn man zur Bundeswehr geht. Das ist eine relativ unbekannte Verwendung, zumal es in Deutschland nur 94 Dienstposten als Jugendoffizier gibt, es ist ein Randphänomen innerhalb der Bundeswehr.
Als ich nach dem Studium in meiner Verwendung als Stabszugführer eingesetzt war, lag es in meiner Verantwortung für meine Soldat_innen politische Bildung zu planen. Laut Vorschrift haben wir den Luxus, mindestens einmal im Jahr eine größere Weiterbildung zu veranstalten. Und im Zuge der Vorbereitung dafür bin ich mit einem Kameraden in Verbindung gekommen, der die Jugendoffiziere in Deutschland als fachliche Aufsicht betreut. Der hat mir von dieser Tätigkeit berichtet. Verbunden ist diese mit zwei Lehrgängen, der erste fünf, der zweite drei Wochen, in denen man sich für diese Tätigkeit qualifizieren muss. Inhalte dieser Lehrgänge sind Kommunikationstraining, aber auch Sachunterricht zum Thema Sicherheitspolitik.
Nachdem ich den ersten Lehrgang beendet habe, habe ich mich dann auch offiziell über meinen Personalführer für den Dienstposten hauptamtlich bemüht. Das Amt des Jugendoffiziers ist mit Eigeninitiative verbunden; wenn man das machen möchte, muss man sich für die Lehrgänge bewerben, einschreiben und am besten den Vorgesetzten über die Pläne informieren. Wenn der einen unterstützt, hat man ganz gute Chancen. Hauptamtlich mache ich das jetzt seit Oktober 2019 am Standort Veitshöchheim.
Hauptmann Christian Rumpel: Ich habe Bauingenieurwesen studiert und mit dem Gedanken gespielt, was ich nach der Zeit bei der Bundeswehr mache. Es gibt ein Programm, dass man als Bauingenieur als Quereinsteiger ohne Studium als Lehrer an einer Berufsschule arbeiten kann. Da ich nicht wusste, ob es mir liegt, vor Schülern zu unterrichten, wollte ich es ausprobieren, bin auf die Lehrgänge gegangen und habe geschaut, ob das etwas für mich ist. Der andere Beweggrund: Wir, meine Familie und ich, haben damals in München gewohnt. Ich hatte dann die Möglichkeit, mich selbst nach einem neuen Dienstposten zu erkundigen; wir wollten zurück in die fränkische Heimat und hier in Veitshöchheim war der Posten des Jugendoffiziers frei.
Zwischenbemerkung: Gibt es eine zeitliche Begrenzung von vorneherein oder können Sie sagen, Sie bleiben so lange, wie sie wollen?
Hauptmann Christian Rumpel: Die Funktion ist zeitlich begrenzt auf vier Jahre. Man sollte schauen, dass man möglichst lange auf einem Dienstposten ist, um notwendige Kontakte zu knüpfen. Je länger desto besser und bei unserem doppelten Dienstposten ist es wichtig, dass ich meine Kontakte weitergebe, damit diese bleiben. Manche Jugendoffiziere schaffen es, länger als vier Jahre auf dem Dienstposten zu sein, weil es ihnen so gut gefällt oder es familiär oder örtlich gerade ganz gut passt. Es ist nicht selten, dass man dies sechs, sieben Jahre macht.
L. Sch.: Worin besteht die Aufgabe eines Jugendoffiziers?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Ich finde, der Begriff „Jugendoffizier“ ist zunächst ein bisschen irreführend; ursprünglich hat er sich auf die Zielgruppe bezogen. Im Grunde genommen sprechen wir als Jugendoffiziere aber generell die interessierte Öffentlichkeit an; in dem Sinne sind wir ein Bindeglied zwischen der Bundeswehr und der Gesellschaft. Unser hauptsächliches Einsatzgebiet sind die öffentlichen Schulen ab der 9. Klasse; wenn die Lehrkräfte uns einladen, stehen wir zur Verfügung, stehen wir Rede und Antwort in Bezug auf sicherheitspolitische Fragen.
Im Grunde genommen sind wir ja auch meistens der Erstkontakt für die Schüler_innen, was die Bundeswehr angeht. Die Bundeswehr ist in der Bevölkerung nicht mehr so präsent; für viele sind wir die ersten Soldaten, mit denen man ins Gespräch kommen kann. Im Grunde genommen ist unser Hauptauftrag, politische Bildung zu vermitteln und die Verbindung zwischen Bundeswehr und Gesellschaft herzustellen.
L. Sch.: Wie – glauben Sie – ändert sich die Haltung junger Leute zur Bundeswehr durch die Arbeit der Jugendoffiziere?
Hauptmann Christian Rumpel: Ich hatte es schon oft, dass ich in Schulen eingeladen wurde, in Klassen mit Schülern, von denen es vorher per E-Mail hieß, dass sie der Bundeswehr sehr kritisch gegenüber stehen; und dann gab es gerade in diesen Klassen eine Diskussion, in der man sich super austauschen konnte und in denen dann der Einsatz der Bundeswehr beziehungsweise der deutschen Politik verstanden wurde. Ich denke definitiv, dass die Jugendoffiziere hier eine ganz wichtige Aufgabe haben, weil sie über Sicherheitspolitik viele Dinge erläutern und auch praxisnah vermitteln können. Das ist ganz wichtig. Wir Jugendoffiziere sind auch immer sehr authentisch.
Zwischenbemerkung: Haben Sie den Eindruck, dass die Jugendlichen der Bundeswehr mit Vorbehalten oder einer kritischen Haltung begegnen?
Hauptmann Christian Rumpel: Den Eindruck hatte ich schon teilweise. Es kommt auch immer auf die Region an, die Regionen in Deutschland unterscheiden sich in dieser Hinsicht maßgeblich. Es gibt Jugendoffizieren in Bremen und Hamburg, die einen sehr schwierigen Stand an Schulen haben. Bei uns auf dem Land ist die Einstellung der Bundeswehr gegenüber relativ positiv.
Aber noch wichtiger ist, dass wir in unseren Vorträgen nicht nur über die Bundeswehr sprechen, sondern auch über Migration und Flüchtlinge. Man kann als Jugendoffizier sagen, was in Syrien passiert und warum die Leute auf der Flucht sind – weil eben die Sicherheit nicht gegeben ist und wenn man versucht, die Hintergründe zu vermitteln, zu erläutern, was es für die Leute heißt, auf der Flucht zu sein – da kann man ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Und das betrifft nicht in erster Linie die Bundeswehr, sondern Sicherheitspolitik allgemein.
L. Sch.: Wie sah Ihre Ausbildung aus?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Es kommt immer ganz darauf an, in welcher Laufbahn man sich befindet und welcher Truppengattung man angehört. Ich gehöre zur Luftwaffe, der Chris zum Heer. Obwohl wir beide Hauptleute sind und die Offizierslaufbahn durchlaufen haben, haben wir unterschiedliche Werdegänge. Ich bin 2010 nach meinem Abitur in Thüringen zur Bundeswehr gekommen und habe ein Jahr an der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck verbracht; das war die Grundausbildung, integriert mit zusätzlichem Unterricht: politische Bildung, Wehrrecht, historische Bildung, Werte und Normen, das Grundgesetz. Letzten Endes bekommt man nach ein paar Prüfungen das Offizierspatent.
Danach ging es für vier Jahre an die Universität der Bundeswehr nach Hamburg. Dort habe ich Bildungs- und Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Personalmanagement und Berufsbildung studiert. Dort schließt man im Regelfall nach vier Jahren mit dem Master ab. Nach der akademischen Ausbildung tritt man seine Fachausbildung an. Für die militärische Laufbahn und die Truppengattung, für die man eingeplant ist, beginnt die Fachausbildung. 2016 war ich eigentlich nur auf Lehrgängen, erst acht Monate in Hammelburg der Zugführerlehrgang für die Luftwaffensicherungstruppe (der Teil der Luftwaffe, der sich mit dem Schutz von Flugplätzen und Luftwaffenanlagen beschäftigt).
Dann habe ich einen Chef-Lehrgang, wieder in Fürstenfeldbruck, durchlaufen können und den offiziellen Abschluss der Offizierslaufbahn. Nach diesem Ausbildungsmarathon durfte ich Anfang 2017 meine erste Verwendung als Stabsführer antreten. Danach kamen Aufbaulehrgänge, die jeweils zu dem gepasst haben, was man gerade macht. Ich habe einen Vertiefungs-Lehrgang für politische Bildung, den Jugendoffizierslehrgang und einen Schießausbilderlehrgang gemacht; so baut das aufeinander auf.
Zuerst kommt der Grundlehrgang der Offiziersausbildung, dann der akademische Teil an der Uni, dann Fachlehrgängen und dann alles nach Bedarf, je nachdem was man gerade macht. Man ist unterm Strich schon viel auf Lehrgängen unterwegs.
Hauptmann Christian Rumpel: Bei mir war es etwas anders, weil ich ja beim Heer bin. Bei mir fing es in Hammelburg an; die ersten sechs Monate gab es eine Grundausbildung, wo man als Schüler den ersten Schritt zur Bundeswehr macht, eine Uniform trägt, lernt zu marschieren, die Verhaltensregeln als Soldat beigebracht bekommt, man lernt zu schießen, treibt viel Sport, versucht, draußen im Wald sich eine Woche am Leben zu halten, eine Art „Survival-Training“. Dann ging es mit den Offizierslehrgängen weiter.
Als Offizier eingestellt zu werden, heißt, noch einmal mehr Führungsverantwortung zu bekommen, so im Rahmen eines Zugführerpostens, wo man im Alter von beispielsweise 24 Jahren ungefähr 50 Soldaten unter sich hat. Man hat Personal- und Materialverantwortung, steht sehr schnell mit in der Verantwortung. Nach meinem Studium des Bauingenieurwesens gab es nur einen Zugführerposten in Deutschland, der bekleidet werden konnte, und da habe ich dann zwei Jahre lang Statiken berechnet, also am Computer Baukörper moduliert, die im Einsatz gebaut wurden, dass sie, wenn sie mit Raketen beschossen werden, nicht einfallen. Das habe ich zwei Jahre gemacht und bin dann schon Jugendoffizier geworden. Das ist aber eher eine atypische Ausbildung.
L. Sch.: Wie beteiligt sich die Bundeswehr beim MINUSMA-/EUTM-Einsatz? Worin bestehen die Aufgaben der Bundeswehr dabei?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Die Frage richtet sich an zwei unterschiedliche Einsätze, die aber mit einem Konflikt im Wesentlichen verknüpft sind und das ist der Bürgerkrieg in Mali beziehungsweise die instabile Situation vor Ort: MINUSMA, der Einsatz der Vereinten Nationen, und EUTM, die Trainingsmission der Europäischen Union. Für diese beiden Einsätze gibt es zwei Bundestagsmandate diese sind ganz unterschiedlich ausgelegt.
Die Mission der Vereinten Nationen zielt darauf ab, eine grundsätzliche Atmosphäre der Sicherheit in Mali zu schaffen und ein Waffenstillstandabkommen zu überwachen. 2012 gab es den Aufstand der Tuareg-Rebellen; nach zähem diplomatischem Ringen wurde eine Waffenruhe vereinbart; die UN-Soldaten haben die Aufgabe, mit ihrer Präsenz dafür zu sorgen, dass diese Waffenruhe auch eingehalten wird. Insgesamt reden wir da von ungefähr 12 000 internationalen Blauhelm-Soldaten; die Bundeswehr stellt in diesem Rahmen 1100 Bundeswehrsoldaten.
Hier geht es grundsätzlich erstmal darum, Sicherheit zu schaffen, im Raum präsent zu sein. Es gibt viele Patrouillen, man zeigt sich, bleibt mit der Bevölkerung im Gespräch und hat ein offenes Ohr, weil es letztlich nicht nur ein militärischer Einsatz ist, sondern auch viele Hilfsorganisationen daran beteiligt sind, für die eine gewisse Sicherheit die Grundlage ihres Handelns darstellt. Das ist klar, denn in einem Bürgerkrieg kann keine Aufbauhilfe primär stattfinden. Zu diesen Aufgaben gehört auch Aufklärung im Raum, weil Informationsvorsprung sehr wichtig bei militärischen Operationen ist, wie beispielsweise mit Hilfe von Drohnen. Die Anforderungen im Detail sind dann zum Beispiel das Detektieren von versteckten Sprengfallen, weil das eine Bedrohung ist, die nicht nur die Streitkräfte vor Ort, sondern auch die Bevölkerung betrifft. Und in diesem Konflikt ist es leider so, dass Munitionsteile unentdeckt bleiben oder mit Explosivmitteln versucht wird, Anschläge zu verüben. Dazu sind unsere Kräfte auch vor Ort, um das zu verhindern.
EUTM ist da ganz anders gelagert. Das ist eine Militärmission der Europäischen Union, initiiert auf Bitten der malischen Regierung. Dort geht es im Wesentlichen darum, dass das malische Militär ermächtigt wird, selbst für Sicherheit zu sorgen; das ist das Ziel. Unser Bundestagsmandat beinhaltet 450 deutsche Soldatinnen, aktuell ist aber nur ein Bruchteil vor Ort. Das hat auch damit zu tun, dass es im letzten Jahr einen Putschversuch in Mali gab und Teile des Militärs, aber auch zivile Gruppen mittlerweile eine Übergangsregierung gebildet haben; deshalb war es wochen- und monatelang unklar, wie diese Zusammenarbeit überhaupt weitergeführt werden soll.
Die Ausbildung des malischen Militärs läuft aktuell; es sind 25 Nationen aus der EU beteiligt. Deutschland stellt etwa 10% des Gesamtkontingents. Es ist auch kein Geheimnis, dass es mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden ist. Das malische Militär führt ein gewisses Eigenleben; das geht von Korruption höherer Militärs bis zur Unterschlagung von Waffen und Munition. Darüber muss man offen diskutieren, in Deutschland auch außerhalb des Parlaments, welchen Anteil die EU hier leisten kann und soll. Und es steht auch zur Debatte, inwieweit die EU sich dann an einer Trainingsmission beteiligt für ein Militär, das geputscht hat und mittlerweile die Übergangsregierung stellt. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr Information in Deutschland gibt und sich darüber stärker ausgetauscht wird.
Zwischenbemerkung: Ich fürchte, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht präsent ist, dass Mali im Prinzip mit der größte Einsatz der Bundeswehr überhaupt ist.
Hauptmann Philipp Nürnberger: Definitiv. Man hat Afghanistan vor Augen, weil es natürlich auch in den Medien über Jahre präsent war, was auch damit zusammenhängt, dass in Afghanistan im Laufe der Zeit viele Bundeswehrsoldaten gefallen sind. In Mali sind es bisher zwei gewesen, die bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kamen. Aber nur weil wir da bisher nicht so viele Gefallene zu beklagen haben, heißt das nicht, dass dieser Einsatz weniger gefährlich ist, ganz im Gegenteil; die Sicherheitslage ist sehr angespannt und sowohl die Vereinten Nationen als auch die EU, beide Missionen sind in einem schwierigen Sicherheitsumfeld aktiv.
Zwischenbemerkung: Was ist der Impuls der EU gewesen, sich in Mali derart zu engagieren, zusätzlich zu den Vereinten Nationen? Warum wird neben MINUSMA noch eine EU-Mission nach Mali geschickt?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Die malische Regierung hat 2013 die EU explizit darum gebeten, sich daran zu beteiligen, und letzten Endes geht es auch um deutsche Sicherheitsinteressen. Wir müssen uns überlegen, wo wir uns auf der Weltkarte befinden, nämlich in direkter Nachbarschaft zu Afrika und dementsprechend ist es ein grundlegend europäisches Anliegen, dass unsere Nachbarregion stabil ist. Stabilität geht auch davon aus, dass ein stabiles staatliches Gewaltmonopol herrscht, dass – wie in Deutschland die Polizei im Innern, die Bundeswehr im Äußeren – für Sicherheit sorgen können muss und das ist ein Anliegen der EU.
Hauptmann Christian Rumpel: Warum der Einsatz nicht so im Fokus steht wie der Afghanistan-Einsatz: Wir müssen uns, wenn man den Afghanistan-Einsatz betrachtet, bis 2001 zurückerinnern mit den Anschlägen auf das World-Trade-Center; da stand die ganze Welt unter Schock, und daraufhin ist dieser Einsatz entstanden. Das heißt, die ganze Welt hatte die Augen auf diesem Einsatz, hat nachverfolgt, ob Osama bin Laden gefunden wird oder nicht. In Mali hatte man keinen vergleichbaren Auslöser, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat.
Warum sich die EU nochmal explizit in Mali engagiert, obwohl es die UN schon tut: Dahinter stehen auch ein bisschen wirtschaftliche Interessen. Es gibt große Gebiete in Afrika, in denen vor allem China und Russland präsent sind und mit großen Lieferungen in die Regionen Abhängigkeiten schaffen. Durch diese Abhängigkeiten ergeben sich längerfristig positive Impulse, z.B. insofern als man sich dort langfristig Rohstoffe sichert. China auf der anderen Seite der Welt hat hier schon massiv Einfluss; Russland hinterlässt auch – vor allem militärisch – hier seinen Fußabdruck. Die EU möchte in Mali nichts verschlafen.
L. Sch.: Welche Auswirkungen hat der Einsatz der Bundeswehr in Mali auf Deutschland/die Sicherheit Deutschlands?
Hauptmann Christian Rumpel: Was haben wir Deutschen davon, wenn wir uns in Mali engagieren? […] Wenn man sich im afrikanischen Bereich bewegt, sieht man, dass viele Länder unter großer Instabilität leiden. Das lässt sich daran festmachen, dass zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen stattfinden, ein schwaches staatliches Gewaltmonopol herrscht und es viele Akteure gibt, die ihre eigenen Ziele verfolgen. Das macht es für den Staat nicht einfach, Regeln durchzusetzen. Die Infrastruktur in Afrika ist am untersten Level.
Bei uns in Europa hat man alles im Überfluss, in Afrika funktioniert sehr wenig. Auch mit den Flüchtlingswellen hat man gemerkt, dass, wenn man nicht versucht, Afrika Zukunftsperspektiven zu bieten, es uns vor große Herausforderungen stellen wird, z.B. durch die Menschen, die von dort aus fliehen.
Und wenn man sich jetzt den Berater von Frau Merkel ansieht, einen absoluten Afrika-Experten, weiß man, wie unsere deutsche Politik ausgelegt ist: Wir schauen in Richtung Süden über das Mittelmeer hinaus und versuchen dort vor Ort die Probleme zu lösen, um sichere Strukturen bieten zu können, dass es den Leuten in ihrer eigenen Heimat gut geht und sie nicht gezwungen sind, wo anders Sicherheit finden zu können. Damit ist auch die Frage zu beantworten, was das Ziel des Mali-Einsatzes der Bundeswehr ist: vor Ort Sicherheit schaffen, um im eigenen Land die Systeme zu entlasten und vor der eigenen Haustür keine Konflikte oder Kriege zu haben.
L. Sch.: Wie stehen Sie zur geplanten Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Also grundsätzlich glaube ich, dass es aktuell keine politischen Mehrheiten für die Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht gibt. So eine Debatte anzustoßen ist immer auch ein politischer Akt, um sich zu positionieren und gewisse Denkanstöße zu geben. Die Wehrpflicht, wie sie in der Praxis damals auch gelebt wurde, halte ich ganz persönlich für weder gerecht, noch besonders effektiv für die ganze Kohorte. Man konnte, wenn man eingeladen wurde, ein Schreiben aufsetzen, in dem man sich gegen die Wehrplicht ausgesprochen hat und konnte stattdessen Ersatzdienst leisten –den so genannten Zivildienst. Das haben auch viele Freunde von mir damals gemacht und es nicht bereut. Allerdings gab es für diejenigen aus dem Jahrgang, die ausgemustert wurden, weder das eine, noch das andere. Innerhalb des Jahrganges bestand also wenig Gerechtigkeit und – mal ganz davon abgesehen – hat die Frauen hat gar keiner gefragt.
Was ich spannend fände als Denkanstoß wäre eine Art „Dienstjahr“, in dem sich jede_r eines Abschlussjahrgangs für einen Dienst an der der Gesellschaft entscheiden kann. Ich glaube, das würde unterm Strich auch keiner bereuen. Diejenigen, die möchten, können Wehrdienst leisten; sie können in einer Einrichtung für behinderte Menschen arbeiten, in der Altenpflege, beim Bund e.V. Naturschutz oder in Umweltorganisationen. Und ich glaube auf einer solchen Basis, auf der sich jeder nach seinen Neigungen für die Gesellschaft engagieren könnte, wäre das ein Gewinn für die Jugendlichen und die Gesellschaft.
Dann ist die Frage, ob es politische Mehrheiten dafür gibt; es gibt auch Stimmen, die dagegen sind – es heißt, man „klaue“ der Jugend ein Jahr, aber ich weiß nicht, ob das ein großer Akt des „Klauens“ wäre, denn ich kenne niemanden, der Zivil- oder Wehrdienst geleistet hat und sagt: „Das hat mir hat nichts gebracht.“ Zum Zeitpunkt, zu dem man das tut, mag das frühe Aufstehen oder das Erledigen von Aufgaben, die nicht unbedingt Spaß machen, erstmal blöd sein; aber unterm Strich kann jeder an diesen Aufgaben wachsen. Diese Debatte wird immer mal wieder angestoßen und verschwindet nach zwei Tagen wieder. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es aktuell keine politische Mehrheit dafür gibt und dies auch nach der Bundestagswahl absehbar erst einmal so bleiben wird.
Hauptmann Christian Rumpel: Aus der Sicht der Bundeswehr sind die ganzen Strukturen, um im großen Stil Wehrpflichtige auszubilden, schon eingedampft; es gibt die Kapazitäten nicht mehr, um eine solche Ausbildung zu betreiben; es würde wahrscheinlich Jahre dauern, bis man das wieder angelegt hätte.
Die andere Frage lautet: Hat die Bundeswehr genug Leute ohne die Wiedereinsetzung? In den Führungspositionen – Offiziersanwärter etc. – gibt es genügend Bewerber. Es kommen auf eine Offiziersstelle – habe ich mir sagen lassen – ungefähr vier Bewerber, auf eine Feldwebelstelle drei und auf eine Mannschaftsdienstagradstelle 1,2 Bewerber. Die Zahlen gehen zurück. Dementsprechend ist es auch schwerer, gutes Personal gewinnen zu können, aber das ist auch ganz klar, wenn man sich den Arbeitsmarkt ansieht: Im Moment kann sich der Schulabsolvent den Arbeitgeber aussuchen. Vor ein paar Jahren war das noch umgekehrt, ein Betrieb konnte aus mehreren Bewerbern auswählen, das hat sich geändert und betrifft uns bei der Bundeswehr genauso.
Zum Thema Freiwilligenjahr: Auch ich empfände das als richtig; es herrschte mehr Gleichberechtigung; die Leute könnten frei entscheiden, was sie machen wollen; eine gewisse „Selbstfindung“ wäre gegeben. Die Gesellschaft in Deutschland hat sich auch etwas gespalten; dies würde dazu beitragen, dass man wieder etwas zusammenrückt.
L. Sch.: Wie sehr belasten Sie Vorurteile, die gegenüber der Bundeswehr herrschen (Vorurteile vorgeblich herrschenden Militarismus betreffend; die Bundeswehr als vorgeblich potentielle Anlaufstelle für Rechtsextremisten etc.)?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Für mich ist es Ansporn, als Jugendoffizier diesbezüglich mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen. Letzten Endes ist es ein Ausschnitt, der in der Öffentlichkeit gezeigt wird und wir Soldaten kennen natürlich ein paar andere Seiten unserer Institution, die das Gesamtbild abrunden würden. Wir (die Jugendoffiziere, Anm. d. Verf.) sind in der Situation, dass wir regelmäßig mit der Öffentlichkeit in Kontakt kommen, darüber sprechen und auch ein anderes Bild zeigen können.
Es ist richtig, auf Missstände hinzuweisen und zu fordern, dass konsequent aufgearbeitet wird. Diese Vorurteile entspringen gewissen Anhaltspunkten. Schade, dass es die gibt und das sollte sich ändern. Es sind teilweise Vorurteile, die auch gelebt werden; wenn derjenige, der das tut, auch offen ist, mit der Bundeswehr ins Gespräch zu kommen und nicht nur über die Bundeswehr zu sprechen, wäre mit einer solchen Debattenkultur schon viel gewonnen. Ich wünsche mir von allen Beteiligten eine gewisse Offenheit, um ein bisschen mehr miteinander als übereinander zu sprechen. Ein konkretes Beispiel: Ich war mal in einer Klasse der Berufsschule und es gab eine Schülerin, von der mir die Lehrerin schon vorher gesagt hatte, sie sei ein bisschen der Antifa zugeneigt und ich könnte mich auf einige Fragen gefasst machen. Im Laufe des Vortrages hat sie sich aber offen gezeigt, viele Fragen gestellt, die ich ehrlich beantwortet habe. Als die Stunde zu Ende war, hat sie dann gesagt: „Ich habe im Prinzip mir gar nichts erhofft, aber diese Hoffnung haben Sie enttäuscht, es war ganz okay.“ ist Dass man die eigenen Vorurteile mal für 90 Minuten zur Seite legt und zuhört, das würde ich mir schon wünschen.
Hauptmann Christian Rumpel: Ich finde es auch gut, dass vieles in der Presse angesprochen wird, z.B. Materialdefizite; es entsteht ein gewisser politischer Druck, der auch von den Oppositionsparteien aufgegriffen wird.
Was mich ärgert, ist, dass Fälle wie Franco A. auf die gesamte Bundeswehr projiziert werden. Die Bundeswehr hat 184 000 Soldaten, dass da ein paar rechtsradikale Soldaten dabei, entspricht leider dem Querschnitt der Gesellschaft. Aber ich habe in meiner zwölfjährigen Diensterfahrung mit hunderten von Soldaten gesprochen und Freundschaften geschlossen und ich haben bis jetzt niemanden mit rechtsradikalen Tendenzen kennengelernt. Die mediale Aufbereitung solcher Fälle finde ich schade; aber das ist leider so, damit muss man klarkommen.
L. Sch.: Sehen Sie sich als „Bürger in Uniform“ von Ihren Mitbürgern als solcher wahrgenommen?
Hauptmann Philipp Nürnberger: Dieses Leitbild „Bürger in Uniform“ ist etwas, was man schon in den ersten Tagen der Grundausbildung mitbekommt. Es sagt letztendlich aus, dass die Streitkräfte kein Eigenleben führen, sondern dass wir aus der Mitte der Gesellschaft kommen, unterschiedliche Einstellungen und Präferenzen haben und dass das gerade durch die Vielfalt in der Truppe widergespiegelt werden soll. Ich persönlich nehme mich schon als „Staatsbürger in Uniform“ wahr.
Seitdem ich Jugendoffizier bin, komme ich sehr oft mit Freunden und Bekannten ins Gespräch über solche Themen. Die Funktion des Jugendoffiziers zieht sich bis ins Privatleben hinein. Ich würde also schon sagen, dass es zutrifft; ob allerdings viele in der Gesellschaft damit etwas anfangen können, wage ich zu bezweifeln, weil dieses Leitbild vielen gar nicht bekannt ist.
Hauptmann Christian Rumpel: Ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob ich in Zivil oder in Uniform einkaufen gehe. Man wird wahrgenommen, man wird anders angeschaut; ob das positiv oder negativ ist, kann ich nicht sagen; negative Erfahrungen habe ich noch nie gemacht.
Was ich als krasses Gegenbeispiel empfinde: Bei der Ausbildung sind wir damals in die USA geflogen; dort war die Dienstreise mit Uniform vorgeschrieben. Und in den USA ist es ein ganz anderes Standing. Die Leute sprechen einen an und danken für den Service, den man für sein Land leistet: „Thank you for your service.“ Das ist natürlich das krasse Gegenbeispiel, das einem fast schon unangenehm wird. Ein Zwischending wäre aber ganz schön, dass die Leute wertschätzen, dass man seinem Land dient, und auch wertschätzen, was die Bundeswehr macht. Das muss keine Lobeshymne sein, einfach ganz normale Anerkennung. Nix‘ g‘sagt ist gelobt g‘nug, wie man in Franken sagt.
L. Sch.: Wir danken Ihnen sehr für das Gespräch.